![Kletterführer-IMG_0612]() Die schweren, gebundenen roten Bücher sind eigentlich eher unpraktisch für den Gebrauch in der Wand – und dennoch sieht man sie in fast jedem Bücherschrank ambitionierter Alpinkletterer. Die Rede ist von den Topoguide-Führern. Sie sind anders, umfangreicher, genauer, zuverlässiger, liebevoller – oder kurzum: Sie sind so, wie man es sich von einem vertrauenserweckenden Alpinkletterführer wünscht. Aber wie kam es zu diesen Büchern? Und wer steckt dahinter? Und woher nehmen die überhaupt die Zeit, so viel zu klettern? Ich habe mal bei Nicole und Volker nachgefragt:
Die schweren, gebundenen roten Bücher sind eigentlich eher unpraktisch für den Gebrauch in der Wand – und dennoch sieht man sie in fast jedem Bücherschrank ambitionierter Alpinkletterer. Die Rede ist von den Topoguide-Führern. Sie sind anders, umfangreicher, genauer, zuverlässiger, liebevoller – oder kurzum: Sie sind so, wie man es sich von einem vertrauenserweckenden Alpinkletterführer wünscht. Aber wie kam es zu diesen Büchern? Und wer steckt dahinter? Und woher nehmen die überhaupt die Zeit, so viel zu klettern? Ich habe mal bei Nicole und Volker nachgefragt:
Nicole, Volker. Mal ehrlich – wenn man in Euren Büchern schmökert, entsteht der Eindruck, Ihr würdet das ganze Jahr über nichts anderes machen als alpinklettern. Stimmt das?
Wenn es nach Volker ginge, wäre das bestimmt wirklich so! ![;-)]() Aber wir sind eigentlich „nur“ etwa 8-10 Wochen im Jahr alpin unterwegs. Dass dabei doch recht viele Touren zusammen kommen liegt vor allem daran, dass wir zeitlich flexibel sind und dann losfahren, wenn das Wetter gut ist und nicht, wenn wir Urlaub geplant haben. Volker ist unser „Wetterfrosch“ und beobachtet regelmäßig, wann wo die besten Bedingungen sind, und wenn sich ein stabiles Hoch abzeichnet, packen wir kurzfristig die Sachen und fahren los. Kaspar Ochsner, den wir mal auf der Engelhornhütte getroffen haben, hat es so auf den Punkt gebracht: „Wenn’s gut ist, musst du geh’n!“ Wir richten uns natürlich auch in Sachen Zielwahl nach dem Wetter und sind aus diesem Grund vor allem in den letzten drei, vier Jahren immer öfter in die Dauphiné gefahren, weil dort einfach ganz oft bestes Wetter herrscht, während es in Chamonix, der Schweiz oder auch in den Dolomiten zu unsicher war.
Aber wir sind eigentlich „nur“ etwa 8-10 Wochen im Jahr alpin unterwegs. Dass dabei doch recht viele Touren zusammen kommen liegt vor allem daran, dass wir zeitlich flexibel sind und dann losfahren, wenn das Wetter gut ist und nicht, wenn wir Urlaub geplant haben. Volker ist unser „Wetterfrosch“ und beobachtet regelmäßig, wann wo die besten Bedingungen sind, und wenn sich ein stabiles Hoch abzeichnet, packen wir kurzfristig die Sachen und fahren los. Kaspar Ochsner, den wir mal auf der Engelhornhütte getroffen haben, hat es so auf den Punkt gebracht: „Wenn’s gut ist, musst du geh’n!“ Wir richten uns natürlich auch in Sachen Zielwahl nach dem Wetter und sind aus diesem Grund vor allem in den letzten drei, vier Jahren immer öfter in die Dauphiné gefahren, weil dort einfach ganz oft bestes Wetter herrscht, während es in Chamonix, der Schweiz oder auch in den Dolomiten zu unsicher war.
![Kletterführer]() Bleibt da noch Zeit für andere Dinge als das Klettern, Schreiben und Layouten? Arbeitet ihr auch?
Bleibt da noch Zeit für andere Dinge als das Klettern, Schreiben und Layouten? Arbeitet ihr auch?
Ich (Nicole) habe mit dem Sportwelt Verlag (www.sportweltverlag.de) noch einen Verlag, der ein breiteres Publikum anspricht und lektoriere außerdem gelegentlich Buchmanuskripte für andere Verlage. Ansonsten steht das Klettern schon sehr im Fokus. Schließlich ist es ja wichtig, fit zu bleiben, um dann alpin auch anspruchsvolle Touren machen zu können, und dafür ist auch hier im Frankenjura einiges an Training nötig. Volker ist Vollzeitkletterer und wird es hoffentlich auch noch lange bleiben.
Eure Bücher sind offensichtlich mit viel Liebe und sehr viel investierter Zeit gemacht. Wie kam es zu der Idee, gleich ein eigenes Buch herauszubringen?
Den Grundstein hat ein verlorener Autoschlüssel gelegt; dass ein Buch daraus wurde, hat sich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und zwar so: Als wir 2002 die 1.900 Meter lange Nordkante des Monte Agner gemacht hatten, kamen wir im Abstieg am Rifugio Scarpa vorbei, wo ich etwas trinken wollte. Volker gab mir dann sein Mäppchen mit dem Geld, und als er es wieder einsteckte, vermisste er den Autoschlüssel. Nach einigem Hin und Her stellte sich heraus, dass der sich durch ein Loch in der Hosentasche verabschiedet hatte und wir keinen Ersatz dabei hatten. Zwar konnte uns unsere Nachbarin per Expressdienst einen Zweitschlüssel zusenden, aber mit Hotelübernachtung hat der Spaß etwa 200 Euro gekostet. Da die Agner Nordkante einer der großen „Pause-Klassiker“ (aus dem Buch „Im extremen Fels“ von Pause/Winkler) ist und es damals keine einzige brauchbare Beschreibung oder gar ein Topo gab, kam uns in den Sinn, eins zu zeichnen, eine Internetseite einzurichten und das Topo für ein paar Euro anzubieten, um vielleicht irgendwann die 200 Euro wieder reinzuholen. Na ja, und es ist eben nicht bei dem einen Topo geblieben…
Und wie lange hat es dann von der Idee eines ganzen Buches bis hin zur Veröffentlichung von Band I gedauert?
Ziemlich genau fünf Jahre. Wobei Volker im „Jahrhundertsommer“ 2003 mit einem Freund drei Monate lang in Chamonix war und dort jeden Tag (!) beste Bedingungen hatte. So konnte er dort in einem Sommer mehr Touren machen, als sonst in zehn Jahren möglich sind!
Habt ihr bereits (Buch)Projekte für die Zukunft?
Was das Klettern angeht, sind wir erst mal noch mit Band 3 beschäftigt, der für 2014/15 geplant ist, und vielleicht einer Ergänzung zu unserem Korsikaführer.
Zum Thema Alpinklettern:
In eurem Leben scheint sich viel um das Klettern zu drehen. Könnt Ihr in Worte fassen, worin für Euch der Reiz im Alpinklettern liegt?
![Die Topoguide-Autoren bei der Datenaufnahme]() Die Kombination aus toller Landschaft, körperlicher Anstrengung, schönen Bewegungen, kritischer Selbsteinschätzung, nur sich selbst verantwortlich zu sein. Erlebnisse mit dem Partner und der eigenen Psyche.
Die Kombination aus toller Landschaft, körperlicher Anstrengung, schönen Bewegungen, kritischer Selbsteinschätzung, nur sich selbst verantwortlich zu sein. Erlebnisse mit dem Partner und der eigenen Psyche.
Und was das Klettern anbelangt, sind Alpintouren einfach die „Kinglines“. Denn im Gegensatz zu Klettergartenrouten werden hier viele Seillängen am Stück geklettert. Es entsteht quasi ein Flow, der spätestens ab der 30. Seillänge in Trance übergeht. ![;-)]()
Angst und Überwindung gehören zum Klettern dazu wie der Kaffee oder das Biwak – manchmal gerät man aber doch in Situationen, in denen man etwas Glück braucht. Was war eure brenzligste Situation am Berg?
Da gab es einige. Gerade in diesem Sommer wieder hatten wir Riesenglück, und zwar in einer eigentlich bombenfesten Sportklettertour in der Brenta. Als Volker allerdings vom Stand weg einen Fuß an einen Riesenblock lehnte, der eindeutig zur Tour gehörte, rauschte dieser mit Getöse in die Tiefe – nur Zentimeter an meinem Bein und Fuß vorbei. Wäre der Block höher oder etwas weiter links gewesen, hätte er mich vermutlich erschlagen. Das Seil war allerdings ziemlich ramponiert, und wir konnten von Glück reden, dass von unserem 60m-Doppelseil noch 35 Meter intakt waren, so dass wir überhaupt abseilen konnten. Sonst hätten wir womöglich den Rettungsheli rufen müssen. Und ob der ein kaputtes Seil als Notfall ansieht oder man dann selbst die Rettungskosten tragen muss… ?
Steinschlag ist generell die am schwierigsten zu kalkulierende Gefahr. Und an dieser Stelle raten wir allen, die in Alpinrouten mit einem Einfachseil unterwegs sind, sich schnellstmöglich ein Doppelseil anzuschaffen! Denn wenn es mal (womöglich gar während des Kletterns) den einen Seilstrang treffen sollte, gibt es kein Netz oder doppelten Boden mehr. Und vielleicht sollte man auch mal auf eine Route verzichten, wenn nach zu ausgiebigem morgendlichem Chillen schon drei andere Seilschaften vor einem sind.
Glowacz sagt, wir Bergmenschen sind “Jäger des Augenblicks” – wir sind immer auf der Suche nach dem perfekten Moment. Was ist der letzte perfekte Moment, an den Ihr Euch erinnern könnt?
Ich empfinde mich ganz und gar nicht als Jägerin, schon gar nicht als Jägerin irgendwelcher viel zu kurzer Augenblicke. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich die größte Zeit meines Lebens auf der Jagd und somit unzufrieden wäre. Für mich reiht sich vielmehr ein perfekter Moment an den anderen und hat nicht ausschließlich mit dem Klettern zu tun. Dazu gehört also auch, bei Regen einfach mal mit einem guten Buch vor dem Ofen zu sitzen, neue Pläne zu schmieden oder – ja! – auch ein berufliches Projekt zu genießen.
Für Volker ist der perfekte Moment schon kletterbezogener, nämlich wenn ein großer Traum in Erfüllung geht. Aber dann ist der Augenblick auch schon wieder zu Ende. Beim Sportklettern ist es der Moment, wenn die letzte Expresse eines lang ersehnten Projekts geklippt ist und dir das Grinsen für viele Tage nicht mehr aus dem Gesicht geht. Das sind die Momente des Glücks, für die es sich lohnt, allerlei Strapazen auf sich zu nehmen und wirklich zu trainieren. Es ist das Leben im Hier und Jetzt! Andererseits sind diese Momente relativ selten, und es wäre unklug, sich rein auf diese „Gelegenheitszustände“ zu fixieren, um glücklich zu sein. Ein perfekter Moment kann also auch bedeuten, rechtzeitig vor dem Gewitter umgekehrt zu sein.
Für viele ist es wichtig, onsight oder wenigstens rotpunkt eine Alpinroute zu meistern. Bei Euch im Führer ist häufig A0 angegeben. Spielen Onsight-Durchstiege für Euch eine Rolle?
![Nicole am Salbitschijen]() Jein.
Jein. ![;-)]()
Es gibt nur ganz wenige alpine Sportkletterrouten mit homogenen Schwierigkeiten. Als Beispiele wären hier die „Perlen vor die Säue“ oder die „Gente di Mare“ in den Dolomiten zu nennen. In solchen Ausdauerrouten spielt der Begehungsstil dann schon ein besondere Rolle!
Bei einer Route, deren Schlüsselstelle völlig aus dem Rahmen fällt oder sehr boulderlastig ist, ist uns das Rotpunktklettern ziemlich egal. Denn ein VIer-Kletterer wird in einer Alpintour kaum eine VIIIer oder IXer Sequenz ausbouldern. Und manchmal ist eine Tour nicht leicht zu lesen. Dann machen wir uns lieber zwischendurch mal „einen Plan“ und ruhen an einem Haken aus, anstatt aus sportlicher Eitelkeit Kopf und Kragen zu riskieren. So jung sind wir nicht mehr… Meist wiederholt Volker dann die Sequenz, um eine möglichst realistische Bewertung abgeben zu können.
Unsere Bewertungen weichen dann auch durchaus von denen anderer Führerautoren ab, vor allem in klassischen Touren in den Dolomiten, Ostalpen oder auch Wendenstöcken. Unser Ziel ist es, eine einheitliche, zutreffende Bewertung abzugeben, mit der Wiederholer einschätzen können, worauf sie sich einlassen. In verschiedenen Gebieten sind die Bewertungen jedoch sehr speziell, und wurden aus der Zeit, als ein Sechser die Grenze des Menschenmöglichen bezeichnete, einfach in die heutige Zeit übernommen. Oft fällt das kurze Ziehen am Haken glatt unter den Tisch.
In den Wendenstöcken wird dies besonders deutlich, denn wenn im Abstand von anderthalb Metern zwei Haken stecken, dürfte klar sein, wie der Erstbegeher die Stelle gelöst hat. Als Schwierigkeitsangabe steht dort trotzdem meist nur die übliche „6b+“. Den Erstbegehern, die dort Touren erschließen, trauen wir klettertechnisch schon etwas mehr zu. Aber A0 in Kletterführern anzugeben, scheint extrem verpönt zu sein. Oder vielleicht denken die Erstbegeher auch, dass ihre Route nicht wiederholt wird, wenn sie eine zu hohe Freikletterbewertung auswerfen?
Bei langen Touren tickt außerdem die Uhr. Schließlich möchte auch das Topo noch gezeichnet werden (und das machen wir an jedem Stand für die vorherige Seillänge, nicht erst im Nachhinein im Auto).
Auch die Absicherung spielt eine wichtige Rolle: Das gilt nicht nur, wenn die Routen sehr weit gesichert sind und/oder ein Sturz verletzungsträchtig wäre, sondern auch, wenn die Hakenqualität schlecht einschätzbar ist! Wenn wir A0 angeben, sind das (vor allem in Band 1) klassische Routen mit Normalhaken, die einfach nicht zum Freiklettern und Flugtraining einladen.
Wir sind übrigens eigentlich keine Schwierigkeitsdiskutierer. Die Bewertung muss natürlich in etwa passen. Sie sollte aber weder über- noch unterfordern. Falls wir uns mal nicht einig sind, werten wir lieber um ein „Plus“ auf, damit niemand eine böse Überraschung erlebt. Die schönen Urlaubstage sind rar, da sollte ein Klettertag nicht an einer miesen Tourenbeschreibung scheitern! Ein absoluter No-go sind unserer Meinung nach die teilweise um bis zu zwei Grade (!) unterbewerteten Touren, die dann auch noch in den Dolomiten und den Ostalpen als „Genussrouten“ in „Genussführern“ verkauft werden. In „schweren“ Sportklettertouren kehrt sich das Bewertungsphänomen oft sogar um, und wir haben schon öfter mal abgewertet.
Ich persönlich suche immer nach Kletterrouten, die gut abgesichert/absicherbar sind und auf formschöne, markante Gipfel führen. Meinem Partner sind Routen an der Leistungsgrenze in gutem Fels am liebsten – unabhängig von der Umgebung und einem erreichbaren Gipfel. Wonach sucht Ihr eure Touren aus?
„Schrofentouren“ und Resterschließungen, wie es sie mittlerweile recht häufig gibt, interessieren uns nicht! Eine außergewöhnliche Felsqualität mit ebensolchen Kletterstellen und die Absicherbarkeit (die Kombination aus vorhandener Absicherung mit Bohrhaken und mobilen Sicherungsgeräten) sind für uns die Hauptkriterien. Unser Pensum an alpinen Bruchtouren haben wir eindeutig erfüllt. Die Schwierigkeit spielt für uns eine untergeordnete Rolle, wobei es ein Sechser schon sein darf. Allerdings sind wir auch schon des öfteren laut Topo in einen „Fünfer“ eingestiegen, und in unserem topoguide steht dann doch wieder ein Sechser, einfach, weil wir mit der bisherigen Bewertung nicht übereinstimmen und uns auch die Freiheit nehmen, in unseren Führern die Anforderungen einheitlich auf einen modernen Stand zu bringen.
Und die Absicherung? Lieber plaisirmäßig durch die Wand oder mit mehr Abenteuer alte Klassiker wiederholen?
![Cinque Torri, Finlandia]() Wir haben Ende der 80er Jahre mit dem Alpinklettern angefangen, als es nur wenige Bohrhakenrouten gab. Von daher sind wir in unserer Sturm-und-Drangzeit erst mal ziemlich abenteuerlich unterwegs gewesen und haben einige der großen Klassiker wiederholt. Im Laufe der Zeit haben wir allerdings gemerkt, dass das auch gefährlich werden kann, nicht zuletzt, wenn man bei einem Wetterumschwung an alten Rosthaken nicht abseilen kann oder wenn man sich verletzt. Oder die Bewertungen in den Führern nicht passen. Oder gleich die ganze Tourenbeschreibung. Auch durch das regelmäßige Klettern im Klettergarten steigt einfach das Risikobewusstsein. Und so sind wir in den letzten Jahren verstärkt in Routen mit einer soliden Grundabsicherung (möglichst mit Bohrhaken) unterwegs, die sich zusätzlich mit Friends und Keilen absichern lassen. Ob bzw. wie gut das geht, hängt wiederum sehr vom Gestein ab. Während sich ein Granitriss perfekt mit Friends selbst absichern lässt, ist das im Kalk oft nur unzuverlässig möglich. Und so sind unsere Kalktouren eher Bohrhakenrouten, während wir im Granit gern Klassiker klettern. Wenn’s nicht gerade Platten sind, die uns als Frankenjurakletterern aber ohnehin nicht besonders gut gefallen.
Wir haben Ende der 80er Jahre mit dem Alpinklettern angefangen, als es nur wenige Bohrhakenrouten gab. Von daher sind wir in unserer Sturm-und-Drangzeit erst mal ziemlich abenteuerlich unterwegs gewesen und haben einige der großen Klassiker wiederholt. Im Laufe der Zeit haben wir allerdings gemerkt, dass das auch gefährlich werden kann, nicht zuletzt, wenn man bei einem Wetterumschwung an alten Rosthaken nicht abseilen kann oder wenn man sich verletzt. Oder die Bewertungen in den Führern nicht passen. Oder gleich die ganze Tourenbeschreibung. Auch durch das regelmäßige Klettern im Klettergarten steigt einfach das Risikobewusstsein. Und so sind wir in den letzten Jahren verstärkt in Routen mit einer soliden Grundabsicherung (möglichst mit Bohrhaken) unterwegs, die sich zusätzlich mit Friends und Keilen absichern lassen. Ob bzw. wie gut das geht, hängt wiederum sehr vom Gestein ab. Während sich ein Granitriss perfekt mit Friends selbst absichern lässt, ist das im Kalk oft nur unzuverlässig möglich. Und so sind unsere Kalktouren eher Bohrhakenrouten, während wir im Granit gern Klassiker klettern. Wenn’s nicht gerade Platten sind, die uns als Frankenjurakletterern aber ohnehin nicht besonders gut gefallen.
Apropos Plaisir: Nicht bei allem, was als Plaisirtour vermarktet wird, ist auch Vergnügen zu erwarten! Nach unserer Definition darf eine Plaisirtour keine gesteigerten Anforderungen an Wegfindung oder eigenverantwortliche Absicherung stellen. Das ist in der Regel eher selten der Fall und besonders in der Schweiz weitaus weniger anzutreffen als man meinen möchte! Da lohnt ein Blick über den Tellerrand in die Dauphiné! Plaisir(klettern) – wie es der Name schon sagt – kommt eigentlich aus Frankreich.
Für Klassiker – insbesondere in den Dolomiten – wäre im Hinblick auf künftige Generationen eine sanfte Sanierung wirklich wichtig. Ansonsten werden viele tolle Routen bald nicht mehr nachvollziehbar sein. Kaum einer weiß noch, wo sie wirklich verlaufen. Ein gutes Beispiel hierzu ist die „Detassis“ an der Brenta Alta. Dort gibt es unzählige Verhauer-Varianten, und keiner weiß mehr so genau, wo die Erstbegeher tatsächlich lang sind. Und so geht wie bei der stillen Post immer mehr verloren. Diese alpinen Denkmäler sollten wir besser schützen. Das sind wir den Protagonisten dieses Sports schuldig!
Ihr kommt viel rum – habt ihr eigentlich ein absolutes Lieblingsgebiet? Und weshalb gerade dieses?
![Hannibal Gipfelbank]() Für Volker ist Granit das Nonplusultra, eben weil man dort gut und relativ risikofrei mit Friends eigenverantwortlich unterwegs sein kann. Und zwar am besten im Hochgebirge – also Zentralschweiz und Mont-Blanc-Gebiet – wegen des tollen Ambientes.
Für Volker ist Granit das Nonplusultra, eben weil man dort gut und relativ risikofrei mit Friends eigenverantwortlich unterwegs sein kann. Und zwar am besten im Hochgebirge – also Zentralschweiz und Mont-Blanc-Gebiet – wegen des tollen Ambientes.
Ich mag es eher etwas weniger rau und bin auch kein Fan von Alpenhütten, so dass ich eher die Dolomiten aber auch Dauphiné vorziehe, wo es keine Gletscherzustiege mit dem entsprechenden Bergschrundgewurschtel gibt. Zwar ist mir Kalk deutlich vertrauter als Granit, aber das Wichtigste ist, dass der Fels Griffe hat. Ein Traum ist auch das schweizerische Mont-Blanc-Gebiet um das Doréesbiwak mit Aiguille de la Varappe, Aiguille sans nom und Aiguille d’Orny: griffiger Traumgranit mit guter Bohrhakensicherung, die trotzdem noch Friends erfordert und in einer fantastischen Landschaft liegt, wo keinerlei Straßenlärm zu hören ist und auch nur wenige andere Kletterer sind!
Noch ein Wort zu Euren Topoguide-Führern!
Wir denken, dass unsere topoguides keine Führer sind, wie alle anderen auch. Wir haben uns lange überlegt, was in bisherigen Führern fehlte und hoffen nun, dass wir mit unseren ganzheitlichen Beschreibungen Wiederholer darauf vorbereiten, was sie tatsächlich erwartet. In diesem Sinne wünschen wir allen viel Spaß bei der schönsten Nebensache der Welt!
The post Interview mit den Autoren der Topoguide-Führer appeared first on .
 Welcher es nun ist, der schwerste Gipfel des Allgäus, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass es sich dabei um Felstürme handelt, wo selbst der Normalweg, also der leichteste Weg zum Gipfel, bereits Kletterausrüstung erfordert. Paradegipfel dieser Kategorie sind zum Beispiel die Trettach (3) oder etwas weniger bekannt der Kloppenkarturm (5). Jener, den wir uns gestern ausgesucht haben, war die Siplinger Nadel – eine Konglomerat-Nadel mit nur einer Seillänge, deren leichteste Aufstieg eigentlich eine 5 ist. In Anbetracht des brüchigen Steins, der alten Schlaghaken (in Komglomerat!) und der Tatsache, dass wir auch mit genauem Hinsehen nur maximal zwei dieser Haken gesehen haben, würde ich einmal behaupten, dass hier der Normalweg eher die etwas daneben liegende 6+ ist. Diese Route verläuft im linken Wandteil zwar durch extrem brüchiges Gestein, wartet dafür aber mit verhältnismäßig geringen Hakenabständen und vertrauenserweckend(er)en Haken auf.
Welcher es nun ist, der schwerste Gipfel des Allgäus, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass es sich dabei um Felstürme handelt, wo selbst der Normalweg, also der leichteste Weg zum Gipfel, bereits Kletterausrüstung erfordert. Paradegipfel dieser Kategorie sind zum Beispiel die Trettach (3) oder etwas weniger bekannt der Kloppenkarturm (5). Jener, den wir uns gestern ausgesucht haben, war die Siplinger Nadel – eine Konglomerat-Nadel mit nur einer Seillänge, deren leichteste Aufstieg eigentlich eine 5 ist. In Anbetracht des brüchigen Steins, der alten Schlaghaken (in Komglomerat!) und der Tatsache, dass wir auch mit genauem Hinsehen nur maximal zwei dieser Haken gesehen haben, würde ich einmal behaupten, dass hier der Normalweg eher die etwas daneben liegende 6+ ist. Diese Route verläuft im linken Wandteil zwar durch extrem brüchiges Gestein, wartet dafür aber mit verhältnismäßig geringen Hakenabständen und vertrauenserweckend(er)en Haken auf. Zwar handelt es sich bei dieser Tour keinesfalls um eine alpine Angelegenheit, die es erfordern würde, am Tag zuvor bereits am Zustieg zu sein, aber um vielleicht ein paar schöne Fotos im Sonnenaufgang zu erwischen, fuhren wir am Vorabend bereits nach Balderschwang und übernachteten dort in unserem Bus. Die Nacht war angenehm, das Rauschen des Baches direkt neben uns hatte endlich mal wieder etwas von „Lagerfeuerromantik“. Um 5 Uhr am nächsten Morgen klingelte der Wecker. Ein kurzes Frühstück (wir mussten nur eine Milch von zu Hause mitnehmen – alles andere ist im Bus gelagert – ein großartiges Gefühl
Zwar handelt es sich bei dieser Tour keinesfalls um eine alpine Angelegenheit, die es erfordern würde, am Tag zuvor bereits am Zustieg zu sein, aber um vielleicht ein paar schöne Fotos im Sonnenaufgang zu erwischen, fuhren wir am Vorabend bereits nach Balderschwang und übernachteten dort in unserem Bus. Die Nacht war angenehm, das Rauschen des Baches direkt neben uns hatte endlich mal wieder etwas von „Lagerfeuerromantik“. Um 5 Uhr am nächsten Morgen klingelte der Wecker. Ein kurzes Frühstück (wir mussten nur eine Milch von zu Hause mitnehmen – alles andere ist im Bus gelagert – ein großartiges Gefühl ![]() ), die Bikes aus dem Auto holen, ein letzter Blick auf die Karte und los ging‘s.
), die Bikes aus dem Auto holen, ein letzter Blick auf die Karte und los ging‘s. Die ersten 300 Höhenmeter wollten wir mit den Bikes zurücklegen – „das dauert nicht lang“, dachten wir. Mit schweren Rucksäcken, wo nicht nur das übliche Geraffel wie Wasser, schwere Kamera und Brotzeit, sondern auch Seil und Sicherungsmittel drin waren und den schweren Stiefeln an den Füßen dauerte es dann aber doch etwas. Ein kurzer aber starker Regenschauer zwang uns zudem zu einer kurzen Rast.
Die ersten 300 Höhenmeter wollten wir mit den Bikes zurücklegen – „das dauert nicht lang“, dachten wir. Mit schweren Rucksäcken, wo nicht nur das übliche Geraffel wie Wasser, schwere Kamera und Brotzeit, sondern auch Seil und Sicherungsmittel drin waren und den schweren Stiefeln an den Füßen dauerte es dann aber doch etwas. Ein kurzer aber starker Regenschauer zwang uns zudem zu einer kurzen Rast. Auf Höhe der Oberen Socheralpe tauschten wir Räder gegen Füße und wanderten weiter in Richtung Obere Wilhelminealpe, wo bereits eine durchgehende Schneedecke wartete. Der Weg zum Gipfel führt im Sommer normalerweise recht steil durch schmale Rinnen, die jedoch noch mit dicken Schneefeldern gefüllt waren. Nach etwas gruseligem Schneegeklettere erreichten wir den Siplinger Kopf und genossen ausgiebig unsere Bio-Mahlzeit. Die günstige Miete auf dem Land macht’s möglich. Da mit dem „Gipfelsieg“ für uns die Tour jedoch noch lange nicht rum war, wanderten wir gemütlich über Schneefelder auf der anderen Seite des Gipfel hinunter zur Siplinger Nadel. Nach gut 200 Höhenmetern kam sie ins Blickfeld: Eine aufragende Felsnadel mit kleinem Gipfelkreuz, eine schöne Erscheinung.
Auf Höhe der Oberen Socheralpe tauschten wir Räder gegen Füße und wanderten weiter in Richtung Obere Wilhelminealpe, wo bereits eine durchgehende Schneedecke wartete. Der Weg zum Gipfel führt im Sommer normalerweise recht steil durch schmale Rinnen, die jedoch noch mit dicken Schneefeldern gefüllt waren. Nach etwas gruseligem Schneegeklettere erreichten wir den Siplinger Kopf und genossen ausgiebig unsere Bio-Mahlzeit. Die günstige Miete auf dem Land macht’s möglich. Da mit dem „Gipfelsieg“ für uns die Tour jedoch noch lange nicht rum war, wanderten wir gemütlich über Schneefelder auf der anderen Seite des Gipfel hinunter zur Siplinger Nadel. Nach gut 200 Höhenmetern kam sie ins Blickfeld: Eine aufragende Felsnadel mit kleinem Gipfelkreuz, eine schöne Erscheinung. Schon beim Näherkommen sah der ganze Turm etwas brüchig aus. Konglomerat ist ja von Haus aus nicht das festeste Gestein und jetzt, kurz nach dem Winter, war es schon von vorne rein klar, dass es eine brüchige Angelegenheit werden würde, immerhin bauten wir im Konglomerat-Bouldergebiet „Rottach“ vor wenigen Wochen teilweise ganze Boulder auseinander.
Schon beim Näherkommen sah der ganze Turm etwas brüchig aus. Konglomerat ist ja von Haus aus nicht das festeste Gestein und jetzt, kurz nach dem Winter, war es schon von vorne rein klar, dass es eine brüchige Angelegenheit werden würde, immerhin bauten wir im Konglomerat-Bouldergebiet „Rottach“ vor wenigen Wochen teilweise ganze Boulder auseinander. „Haben wir das halt auch mal gesehen“, war das Fazit beim Zusammenpacken. Irgendwie eine kuriose Unternehmung, aber so legendär, dass man sie ein zweites Mal erleben müsste, war sie nun auch wieder nicht. Wir stiegen die Schneefelder wieder auf und bogen oben am Siplinger Kopf in die einzige Richtung, die wir noch nicht begangen hatten: Den Weg nach Westen. Den alten Skispuren folgend, rutschten wir auf fast durchgehenden Schneefeldern gemütlich zurück zu den Rädern und rollten von hier bis zum Bus.
„Haben wir das halt auch mal gesehen“, war das Fazit beim Zusammenpacken. Irgendwie eine kuriose Unternehmung, aber so legendär, dass man sie ein zweites Mal erleben müsste, war sie nun auch wieder nicht. Wir stiegen die Schneefelder wieder auf und bogen oben am Siplinger Kopf in die einzige Richtung, die wir noch nicht begangen hatten: Den Weg nach Westen. Den alten Skispuren folgend, rutschten wir auf fast durchgehenden Schneefeldern gemütlich zurück zu den Rädern und rollten von hier bis zum Bus. Insgesamt war es ein richtig schöner Tag, der einige Sportarten vereinte. Die Sonne schaffte es zwar nie so richtig durch die Dunstdecke, aber angenehm warm war es dennoch. Und so konnte ich bereits einen weiteren Punkt von meiner „Outdoor-Wunschliste“ abhaken. Das abendliche, phänomenale Burger-Grillen war der perfekte Abschluss für solch einen ersten Mai.
Insgesamt war es ein richtig schöner Tag, der einige Sportarten vereinte. Die Sonne schaffte es zwar nie so richtig durch die Dunstdecke, aber angenehm warm war es dennoch. Und so konnte ich bereits einen weiteren Punkt von meiner „Outdoor-Wunschliste“ abhaken. Das abendliche, phänomenale Burger-Grillen war der perfekte Abschluss für solch einen ersten Mai.![Aktuelle Bedingungen an der Nagelfluhkette]() Die Nagelfluhkette (Mittag bis Buralpkopf) sieht südseitig schon gut begehbar aus.
Die Nagelfluhkette (Mittag bis Buralpkopf) sieht südseitig schon gut begehbar aus.

































































































































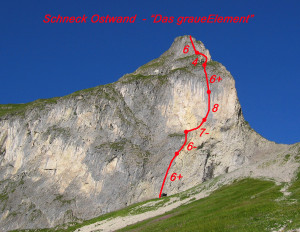












































































 Es ist der dritte Tag für uns hier in Norwegen. Nach einer kleinen Drei-Seillängen-AnDenFelsGewöhn-Tour am Baremslandfjell fiel die Wahl für den nächsten Tag auf eine Tour am Haegefjell. 450 Klettermeter, nur eine Seillänge kürzer als 55 Meter. Borhaken gibt es nur wenige, der Rest wird selbst mit Friends und Keilen abgesichert. Immerhin sind die Stände gebohrt, ein Rückzug wäre also immer möglich. Wenigstens das. Denn es gibt da ein paar Dinge, die mich etwas beunruhigen: Erstens: Ich klettere sehr, sehr ungern Seillängen, die länger als 30 Meter sind, irgendwie geht mir da der Mut auf den letzten Metern aus. Zweitens: Ich habe – bis auf die Tour gestern – noch keine Alpintour im Granit gemacht. Drittens: Wie gesagt, ich halte ganz gerne Griffe in den Pfoten, im Granit ein lächerlicher Wunschtraum. Und überhaupt: Acht Seillängen ist für meine wacklige Höhenpsyche schon ziemlich heftig. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben?!
Es ist der dritte Tag für uns hier in Norwegen. Nach einer kleinen Drei-Seillängen-AnDenFelsGewöhn-Tour am Baremslandfjell fiel die Wahl für den nächsten Tag auf eine Tour am Haegefjell. 450 Klettermeter, nur eine Seillänge kürzer als 55 Meter. Borhaken gibt es nur wenige, der Rest wird selbst mit Friends und Keilen abgesichert. Immerhin sind die Stände gebohrt, ein Rückzug wäre also immer möglich. Wenigstens das. Denn es gibt da ein paar Dinge, die mich etwas beunruhigen: Erstens: Ich klettere sehr, sehr ungern Seillängen, die länger als 30 Meter sind, irgendwie geht mir da der Mut auf den letzten Metern aus. Zweitens: Ich habe – bis auf die Tour gestern – noch keine Alpintour im Granit gemacht. Drittens: Wie gesagt, ich halte ganz gerne Griffe in den Pfoten, im Granit ein lächerlicher Wunschtraum. Und überhaupt: Acht Seillängen ist für meine wacklige Höhenpsyche schon ziemlich heftig. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben?!















































































 Thurgauerweg/Langstraße
Thurgauerweg/Langstraße



















 Ich hatte ja noch darauf gehofft, dass wir da einfach gemütlich durchcruisen würden, aber letztendlich war die 6b noch die schönste Seillänge und die anderen ganz schön schwer für den Grad. Überhaupt, viel war quer durch die Botanik, durch brüchiges Gelände oder halt einfach nicht so schön. Oder waren wir schlicht müde? Obwohl wir beide zwischenzeitlich etwas semi-motiviert waren, stiegen wir sie dann doch noch bis oben durch. Während ich mich auf den letzten Metern zum Gipfelbuch durch fiese Föhren zwängte – mehr Holz als Fels in den Händen (und noch dazu nicht mal sicher, überhaupt noch auf dem richtigen Weg zu sein, man sieht ja nix mit Bäumen im Gesicht), blieb die Motivation irgendwo in den Büschen hängen. Erst als ich nahezu unvermittelt über den letzten Stand stolperte, war doch wieder alles ok. Geschafft! Im doppelten Sinne! Yeah!
Ich hatte ja noch darauf gehofft, dass wir da einfach gemütlich durchcruisen würden, aber letztendlich war die 6b noch die schönste Seillänge und die anderen ganz schön schwer für den Grad. Überhaupt, viel war quer durch die Botanik, durch brüchiges Gelände oder halt einfach nicht so schön. Oder waren wir schlicht müde? Obwohl wir beide zwischenzeitlich etwas semi-motiviert waren, stiegen wir sie dann doch noch bis oben durch. Während ich mich auf den letzten Metern zum Gipfelbuch durch fiese Föhren zwängte – mehr Holz als Fels in den Händen (und noch dazu nicht mal sicher, überhaupt noch auf dem richtigen Weg zu sein, man sieht ja nix mit Bäumen im Gesicht), blieb die Motivation irgendwo in den Büschen hängen. Erst als ich nahezu unvermittelt über den letzten Stand stolperte, war doch wieder alles ok. Geschafft! Im doppelten Sinne! Yeah! Runter…
Runter… Einen Kaffee, einen Chickenburger, eine große Portion Pommes, eine Pizza und eine Bananenmilch später saßen wir dann wieder daheim auf dem sonnigen Balkon und grinsten fröhlich. Ein tolles Wochenende! Und mal wieder mit dem besten Typ der Welt. War auch mal wieder Zeit!
Einen Kaffee, einen Chickenburger, eine große Portion Pommes, eine Pizza und eine Bananenmilch später saßen wir dann wieder daheim auf dem sonnigen Balkon und grinsten fröhlich. Ein tolles Wochenende! Und mal wieder mit dem besten Typ der Welt. War auch mal wieder Zeit!
















 Es machte einfach Spaß, Friends und Keile zu versenken und an diesem massiven Fels unterwegs zu sein. So geil! Leider aber auch viel zu schnell vorbei, denn nach 3,5 Stunden nach unserem Start an der Olpererhütte klatschten wir etwas unterhalb der Gipfelkreuzmeute ab. Vom Normalweg strömten immer neue Leute nach, die sich teils sichtlich unwohl in dem Gelände fühlten.
Es machte einfach Spaß, Friends und Keile zu versenken und an diesem massiven Fels unterwegs zu sein. So geil! Leider aber auch viel zu schnell vorbei, denn nach 3,5 Stunden nach unserem Start an der Olpererhütte klatschten wir etwas unterhalb der Gipfelkreuzmeute ab. Vom Normalweg strömten immer neue Leute nach, die sich teils sichtlich unwohl in dem Gelände fühlten.































 Facts zur Tour:
Facts zur Tour: Während die letzten kommandobrüllenden Seilschaften im Abendlicht abseilen, steigen wir gerade ein und cruisen durch die Wand. Wir genießen die abendliche Ruhe der Berge, verständigen uns lautlos und freuen uns an der abwechslungsreichen Kletterei. Die Handgriffe sitzen, wir sind schnell. Es läuft.
Während die letzten kommandobrüllenden Seilschaften im Abendlicht abseilen, steigen wir gerade ein und cruisen durch die Wand. Wir genießen die abendliche Ruhe der Berge, verständigen uns lautlos und freuen uns an der abwechslungsreichen Kletterei. Die Handgriffe sitzen, wir sind schnell. Es läuft. 







 Kurzzeitig schlechtes Gewissen, dass er garantiert nie wieder mit mir losziehen würde, weil man bei dem Tempo ja gar nie ankommt…
Kurzzeitig schlechtes Gewissen, dass er garantiert nie wieder mit mir losziehen würde, weil man bei dem Tempo ja gar nie ankommt…































 Als ich am dritten Stand ankam, donnerte es entfernt. Während er durch die Schlüssellänge cruiste, wurde es dunkler. Erste Tropfen, als ich über das Dach hinaus war. Einsetzender Hagel, während ich mich in den Stand setzte. Es dauerte keine Minute, bis die Klamotten komplett durchnässt waren. Wir saßen innerhalb weniger Momente mitten in einem kleinen Wasserfall.
Als ich am dritten Stand ankam, donnerte es entfernt. Während er durch die Schlüssellänge cruiste, wurde es dunkler. Erste Tropfen, als ich über das Dach hinaus war. Einsetzender Hagel, während ich mich in den Stand setzte. Es dauerte keine Minute, bis die Klamotten komplett durchnässt waren. Wir saßen innerhalb weniger Momente mitten in einem kleinen Wasserfall. …und doch zufrieden
…und doch zufrieden